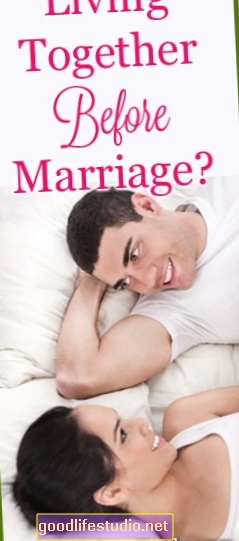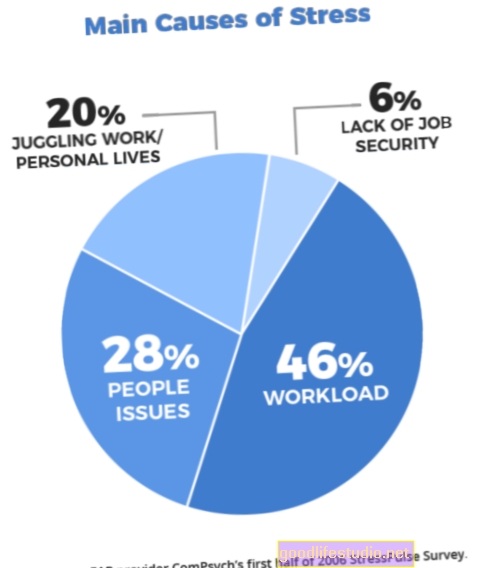Teufel oder Engel? Die Rolle der Psychopharmaka in die richtige Perspektive gerückt
Seiten: 1 2Alle
Als ich in den frühen 1960ern aufwuchs, gab es einen beliebten Song von Bobby Vee namens "Devil or Angel". Ich glaube, es enthielt Texte nach dem Motto: "Lieber, was auch immer du bist, ich brauche dich." Der Titel des Liedes könnte auch eine gute Zusammenfassung der Darstellung von Psychopharmaka in der populären Presse und anderen Medien sein. Und leider fallen sogar einige meiner Kollegen im Bereich der psychischen Gesundheit in eines von zwei bewaffneten Lagern, wenn es um die Rolle von Medikamenten für Stimmung und Verhalten geht. Diese Dichotomie entspricht dem Schisma, das in Tanya Luhrmanns einflussreicher Studie über Psychiatrie mit dem treffenden Titel Von zwei Köpfen. Sehr grob argumentierte Luhrmann, dass der Bereich der Psychiatrie immer noch zwischen jenen aufgeteilt ist, die psychische Erkrankungen als ein psychologisches Problem betrachten, das für psychosoziale Therapien zugänglich ist; und diejenigen, die es als ein Problem abnormaler Gehirnchemie ansehen, das am besten durch Pharmakotherapie behandelt wird. Trotz vieler Versuche, diese konzeptionelle Kluft zu überbrücken - Dr. George Engels „biopsychosoziales Modell“ ist ein Beispiel -, besteht das Schisma bis heute fort.
Und das ist wirklich eine Schande. Die Dichotomie „Engel oder Teufel“ tut niemandem einen Gefallen und hilft sicherlich nicht Patienten mit schwerwiegenden emotionalen Störungen. In Wahrheit ist das menschliche Gehirn der Schmelztiegel, in dem alle Elemente unserer Erfahrung und Empfindung in Denken, Fühlen und Handeln umgewandelt werden. Wir können die Funktion und Struktur des Gehirns direkt beeinflussen, indem wir seine chemischen Bestandteile verändern. oder wir können seine Funktion und Struktur indirekt beeinflussen, indem wir hilfreiche Worte in das Ohr des Patienten gießen. Sprache, Musik, Poesie, Kunst und eine Vielzahl anderer „Inputs“ werden in neuronale Verbindungen und elektrochemische Prozesse im Gehirn umgewandelt.
Dies bedeutet nicht, dass wir unsere Patienten mit der Frage begrüßen sollten: "Wie geht es Ihren Serotoninmolekülen heute Morgen, Mrs. Jones?" Ein Teil unseres gemeinsamen Verhaltens als Mensch ist der Gebrauch von Sprache, die zu unserer gefühlten Erfahrung spricht, nicht zu unseren Neuronen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass unsere Erfahrung letztendlich über die Funktionsweise unseres Gehirns hinausgeht. Darüber hinaus wirken viele Psychopharmaka nicht „kosmetisch“, sondern wirken auf der grundlegendsten Ebene des Gens und erhöhen tatsächlich die Produktion von Nervenwachstumsfaktoren.
Dies sind alles Gründe, warum wir Psychopharmaka nicht sofort abtun sollten. Sie sind keine Agenten des Teufels, wie einige extremistische Fraktionen argumentieren; Sie sind auch keine Engel der Erlösung, wie man aus den Anzeigen einiger Pharmaunternehmen zu „Regenbogen und Schmetterling“ schließen könnte. Psychopharmaka sind, wie ich meinen Patienten erzähle, weder eine Krücke noch ein Zauberstab. Sie sind eine Brücke zwischen einem schlechten und einem besseren Gefühl. Der Patient muss immer noch - manchmal schmerzhaft - über diese Brücke gehen. Dies bedeutet die harte Arbeit, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu ändern. Medikamente können diesen Prozess oft unterstützen und werden manchmal benötigt, um die Arbeit des Patienten in der Therapie in Bewegung zu bringen. Beispielsweise sind einige Patienten mit sehr schwerer Depression so lethargisch und kognitiv beeinträchtigt, dass sie sich nicht vollständig auf eine Psychotherapie einlassen können. Nach drei oder vier Wochen Antidepressivum-Behandlung können viele von ihnen von einer „Gesprächstherapie“ profitieren, die dann einen langfristigen Schutz gegen depressive Rückfälle bietet. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass eine anfängliche Behandlung mit Antidepressiva dazu beitragen kann, den Patienten auf eine nachfolgende Langzeitpsychotherapie vorzubereiten. Wie eine aktuelle Überprüfung von Dr. Timothy J. Petersen [1] ergab,
„… Die sequentielle Anwendung der Psychotherapie nach Einleitung einer Remission mit einer akuten Antidepressivum-Therapie kann eine bessere Langzeitprognose hinsichtlich der Verhinderung eines Rückfalls oder eines Wiederauftretens liefern und für einige Patienten eine praktikable Alternative zur Erhaltungstherapie sein.“
Andere Hinweise deuten darauf hin, dass Gesprächstherapie und Medikamente synergistisch wirken - eine verstärkt die andere. Medikamente können bei „somatischen“ Aspekten von Depressionen wie Schlaf- und Appetitstörungen besser helfen. Psychotherapie, eher mit kognitiven Aspekten wie Schuld oder Hoffnungslosigkeit. Aus Untersuchungen zur Bildgebung des Gehirns geht hervor, dass jede Intervention möglicherweise überlappende, aber etwas unterschiedliche Mechanismen aufweist: Antidepressiva scheinen „von unten nach oben“ zu wirken und die mit Emotionen verbundenen unteren Gehirnzentren zu wecken. Die Psychotherapie scheint von oben nach unten zu wirken, indem sie die neuronalen Muster in höheren Gehirnzentren wie dem präfrontalen Kortex verändert.
Angesichts der riesigen Literatur zu Psychopharmaka konzentriere ich mich in diesem Aufsatz auf Antidepressiva - eine vielfältige Gruppe von Wirkstoffen, die im Mittelpunkt enormer Kontroversen stand. In den letzten Jahren wurden beispielsweise Fragen sowohl zur Wirksamkeit als auch zur Sicherheit von Antidepressiva aufgeworfen. Es gibt eine umfangreiche Literatur zu diesen Themen, aber hier ist meine beste professionelle Zusammenfassung. Antidepressiva scheinen sich bei schweren Depressionen robuster zu zeigen, aber dies kann teilweise ein Artefakt dafür sein, wie die meisten Studien entworfen und analysiert werden. Zum Beispiel legt die jüngste Überprüfung von Kirsch und Kollegen [2] nahe, dass Antidepressiva bei leichten bis mittelschweren Depressionen nicht besser wirken als eine Zuckerpille (Placebo). Bei sehr schweren Depressionen, so Kirsch et al., Übertreffen die neueren Antidepressiva das Placebo, obwohl ihre Vorteile nicht so robust sind wie in früheren Studien (1960er-70er Jahre) der „alten“ trizyklischen Antidepressiva.
Wir müssen diese jüngsten Erkenntnisse jedoch relativieren. Zahlreiche Beiträge im Internet haben basierend auf der Studie von Kirsch et al. Erklärt, dass "Antidepressiva nicht wirken!" Dies hat die Studie jedoch nicht gezeigt. Vielmehr wurden die Ergebnisse von 47 Antidepressivum-Studien zusammengefasst und festgestellt, dass der Wirkstoff nur in den schwersten Fällen von Depressionen eine klinisch signifikante „Trennung“ von Placebo aufwies. Dies ist tatsächlich viel besser als festzustellen, dass Antidepressiva nur bei sehr leichten Depressionen wirken! Die Kirsch-Studie führte den offensichtlichen Nutzen von Antidepressiva bei den schwerkranken Patienten jedoch eher auf eine verminderte Reaktion auf Placebo als auf eine erhöhte Wirksamkeit des Arzneimittels zurück.
Es gibt eine Reihe von Problemen mit der Kirsch-Studie, von denen viele in Dr. Grohols jüngstem Blog (26.02.08) auf dieser Website ausführlich diskutiert werden. Zum einen geht es in der gesamten Kirsch-Studie darum, ob eine 2-Punkte-Verbesserung einer einzelnen Depressionsbewertungsskala (Hamilton Rating Scale for Depression oder HAM-D) eine „klinisch signifikante“ (nicht nur statistisch signifikante) Änderung darstellt. Das ist natürlich eine Frage des Urteils. Zweitens befasste sich die Kirsch-Studie nur mit Antidepressivum-Studien in der FDA-Datenbank, die vor 1999 durchgeführt wurden. Eine Analyse neuerer Studien könnte zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Drittens kann die Art der „Zahlenkalkulation“, die in jeder Metaanalyse (im Grunde genommen eine Studie von Studien) stattfindet, nicht nur individuelle Unterschiede, sondern auch Untergruppenunterschiede verschleiern. Das heißt, ein bestimmter Patient mit bestimmten depressiven Symptomen - oder eine Untergruppe mit bestimmten Merkmalen - kann mit einem Antidepressivum recht gut abschneiden, aber die Ergebnisse sind in der insgesamt mittelmäßigen Erfolgsrate der gesamten Studie „untergetaucht“.
Es gibt viele andere Gründe, warum Studien zu Antidepressiva in den letzten Jahrzehnten möglicherweise weniger als spektakuläre Ergebnisse liefern, und der interessierte Leser kann Details in einem Leitartikel von Kobak und Kollegen im Journal of Clinical Psychopharmacology vom Februar 2007 finden. Diese Autoren weisen unter anderem darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie verzerrt sein können, wenn die Interviews mit HAM-D-Depressionswerten nicht geschickt durchgeführt werden. Kobak und Kollegen wiesen auf mehrere Fälle hin, in denen eine schlechte Befragungstechnik zu Ergebnissen führte, die nur einen geringen Unterschied zwischen Antidepressivum und Placebo zeigten. Umgekehrt führte eine gute Befragungstechnik zu einer robusteren Verbesserungsrate („Effektgröße“) des Antidepressivums. Es ist nicht klar, wie viele solcher „Junk-Interview“ -Studien in die Metaanalyse von Kirsch et al. Aufgenommen wurden.
Seiten: 1 2Alle