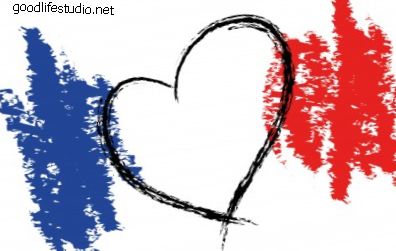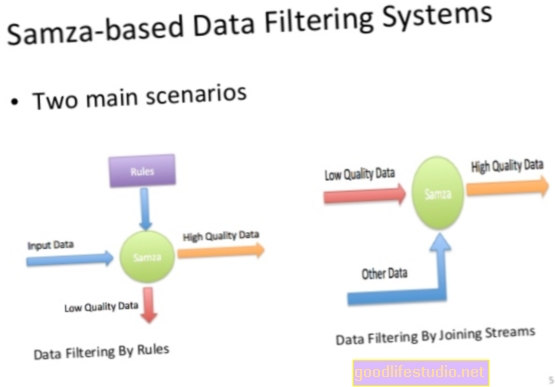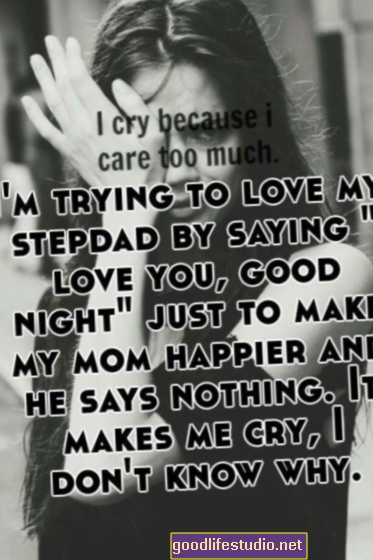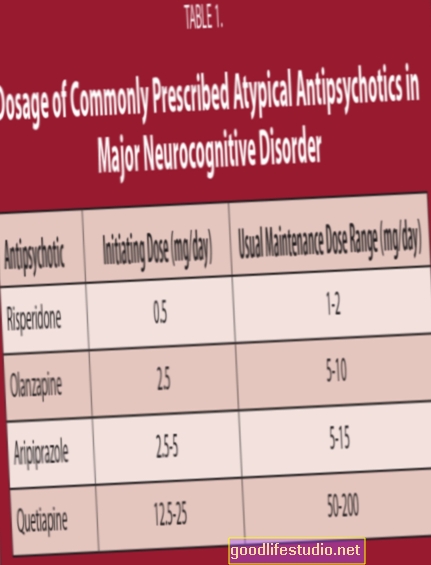Tierverhalten ähnlich wie beim Menschen

In einer neuen Studie haben Wissenschaftler eine Veränderung der DNA eines Gens identifiziert, die sowohl bei Menschen als auch bei Mäusen ein ähnliches angstbedingtes Verhalten hervorruft. Dies zeigt, dass Labortiere genau zur Untersuchung dieser menschlichen Verhaltensweisen verwendet werden können.
Die Ergebnisse könnten Forschern helfen, neue klinische Strategien zur Behandlung von Menschen mit Angststörungen wie Phobien und posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln.
Die Ergebnisse der von den National Institutes of Health finanzierten Studie werden in der Zeitschrift veröffentlicht Wissenschaft.
"Wir fanden heraus, dass Menschen und Mäuse, die die gleiche genetische Veränderung beim Menschen hatten, auch größere Schwierigkeiten hatten, eine ängstliche Reaktion auf unerwünschte Reize auszulöschen", erklärt Dr. BJ Casey, Co-Senior-Autor der Studie und Professor für Psychologie in der Psychiatrie von Weill Cornell Medical College.
Die Forscher beobachteten gemeinsame Verhaltensreaktionen zwischen Menschen und Mäusen, die eine Veränderung des aus dem Gehirn stammenden neurotrophen Faktors (BDNF) aufweisen. Die Mäuse waren genetisch verändert - was bedeutet, dass sie eine humangenetische Variation in ihr Genom eingefügt hatten.
Zu ihrem Vergleich kombinierten die Forscher einen harmlosen Reiz mit einem aversiven, der eine ängstliche Reaktion hervorruft, die als konditionierte Angst bekannt ist. Nach dem Lernen von Angst führt die Exposition gegenüber zahlreichen Präsentationen des harmlosen Reizes allein in Abwesenheit des aversiven Reizes normalerweise dazu, dass Probanden diese Angstreaktion auslöschen.
Das heißt, ein Subjekt sollte irgendwann aufhören, ängstlich auf den harmlosen Reiz zu reagieren.
"Aber sowohl die Mäuse als auch die Menschen, bei denen eine Veränderung des BDNF-Gens festgestellt wurde, brauchten signifikant länger, um die harmlosen Reize zu überwinden und keine konditionierte Angstreaktion mehr zu haben", erklärt Dr. Fatima Soliman, Hauptautorin der Studie.
Zusätzlich zu den Beobachtungstests führten die Forscher Gehirnscans mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) an menschlichen Teilnehmern durch, um festzustellen, ob sich die Gehirnfunktion zwischen Menschen mit abnormalem BDNF-Gen und Menschen mit normalen BDNF-Genen unterschied.
Sie fanden heraus, dass ein Kreislauf im Gehirn, an dem die frontale Kortikalis und die Amygdala beteiligt waren - verantwortlich für das Erlernen von Hinweisen, die Sicherheit und Gefahr signalisieren - bei Menschen mit dieser Anomalie im Vergleich zu Kontrollpersonen, die die Anomalie nicht hatten, verändert war.
"Das Testen auf dieses Gen könnte Ärzten eines Tages helfen, fundiertere Entscheidungen zur Behandlung von Angststörungen zu treffen", erklärt Dr. Francis S. Lee, Co-Senior-Autor der Studie und außerordentlicher Professor für Psychiatrie und Pharmakologie am Weill Cornell Medical College.
Therapeuten verwenden die Expositionstherapie - eine Art Verhaltenstherapie, bei der der Patient mit einer gefürchteten Situation, einem Objekt, einem Gedanken oder einem Gedächtnis konfrontiert ist -, um Personen zu behandeln, die aufgrund bestimmter Situationen unter Stress und Angst leiden.
Manchmal beinhaltet die Expositionstherapie das Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung in einer kontrollierten therapeutischen Umgebung und basiert auf Prinzipien des Extinktionslernens. Ziel ist es, die körperliche oder emotionale Belastung in Situationen zu verringern, die negative Emotionen auslösen. Die Expositionstherapie wird häufig zur Behandlung von Angstzuständen, Phobien und PTBS eingesetzt.
"Die Expositionstherapie kann bei Patienten mit dieser Genanomalie immer noch funktionieren, aber ein positiver Test für die genetische Variante des BDNF kann Ärzte wissen lassen, dass die Expositionstherapie länger dauern kann und dass die Verwendung neuerer Medikamente erforderlich sein kann, um das Extinktionslernen zu beschleunigen", erklärt Dr. Soliman.
Quelle: New Yorker Presbyterianisches Krankenhaus / Weill Cornell Medical Center / Weill Cornell Medical College