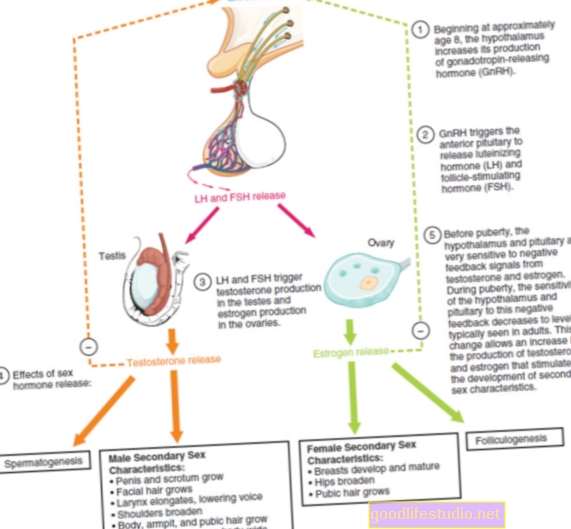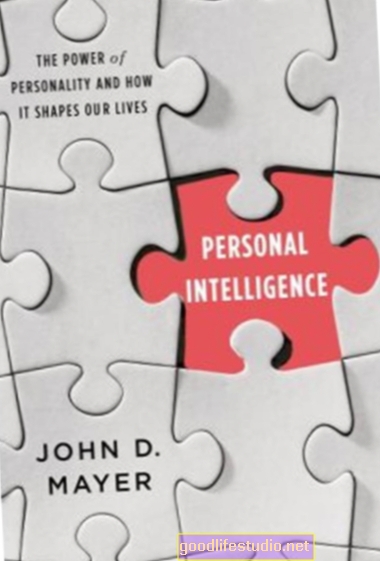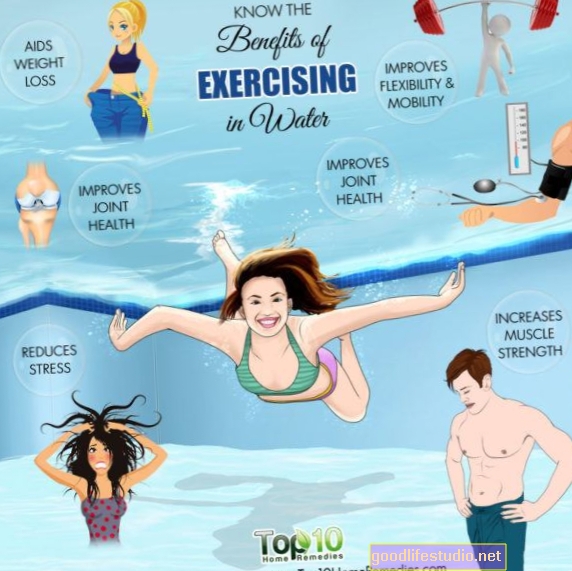Das Internet kann neue Methoden des sexuellen Missbrauchs von Kindern befeuern

Die Behörden wissen, dass sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die Opfer haben kann.
Frühe Studien haben gezeigt, dass sexueller Missbrauch von Kindern mit einem erhöhten Risiko für spätere psychische und physische Gesundheitsprobleme und Risikoverhalten verbunden ist.
Neue Formen sexueller Belästigung treten über das Internet und auf Websites sozialer Netzwerke auf.
Eine neue Studie der Universität Zürich ergab, dass sexueller Missbrauch in einer repräsentativen Stichprobe von mehr als 6.000 Schülern der 9. Klasse in der Schweiz alarmierend weit verbreitet ist.
Sexuelle Belästigung über das Internet wird am häufigsten erwähnt.
Die Studienteilnehmer gaben an, mindestens eine Art sexuellen Kindesmissbrauchs erlebt zu haben. Die Befragten waren hauptsächlich zwischen 15 und 17 Jahre alt, mit rund 40 Prozent Mädchen und 17 Prozent Jungen.
Im Vergleich zu Jungen wurde sexueller Missbrauch ohne körperlichen Kontakt bei Mädchen doppelt so häufig und sexueller Missbrauch mit körperlichem Kontakt ohne Penetration dreimal häufiger gemeldet.
Beide Geschlechter berichteten von „sexueller Belästigung über das Internet“ als häufigste Form des Missbrauchs.
Diese Form des sexuellen Missbrauchs wurde von rund 28 Prozent der Mädchen im Laufe ihres Lebens und von fast 10 Prozent der Jungen erlebt.
Mit knapp 15 Prozent bei Mädchen gegenüber 5 Prozent bei Jungen war „verbal belästigt oder per E-Mail / SMS“ die zweithäufigste Form des Missbrauchs.
Knapp 12 Prozent der befragten Mädchen und 4 Prozent der befragten Jungen gaben an, gegen ihren Willen geküsst oder berührt worden zu sein.
Ungefähr 2,5 Prozent der Mädchen hatten bereits sexuellen Missbrauch mit Penetration (vaginal, oral, anal oder andere) erfahren; bei den Jungen waren es 0,6 Prozent.
Die Ergebnisse der Zürcher Studie sind vergleichbar mit denen einer früheren Schweizer Studie, die zwischen 1995 und 1996 in Genf in einer ähnlichen Altersgruppe durchgeführt wurde und ähnliche Fragen stellte.
Die Prävalenz von sexuellem Missbrauch bei körperlichem Kontakt ist heute nahezu unverändert. Sexueller Missbrauch ohne körperlichen Kontakt tritt jedoch weitaus häufiger auf.
„Wir glauben, dass dieser Unterschied auf Belästigung über das Internet, E-Mail oder SMS zurückzuführen ist. Diese Art des sexuellen Missbrauchs wurde damals nicht untersucht “, sagte Dr. Meichun Mohler-Kuo, leitender Wissenschaftler an der Universität Zürich.
Etwas mehr als die Hälfte der weiblichen Opfer und mehr als 70 Prozent der männlichen Opfer gaben an, von einem jugendlichen Täter missbraucht worden zu sein.
Darüber hinaus kannten die meisten Opfer sexuellen Missbrauchs mit körperlichem Kontakt den Täter - zum Beispiel waren sie Partner, Gleichaltrige oder Bekannte.
"Dieser neue Trend, dass die Mehrheit jugendliche Täter sowie Gleichaltrige und Bekannte sind, steht im Gegensatz zur Genfer Studie und könnte auf ein verstärktes gewalttätiges Verhalten bei Jugendlichen hinweisen", sagte der Forscher Ulrich Schnyder, Ph.D.
Er fügte hinzu: "Unsere Ergebnisse unterscheiden sich auch erheblich von offiziellen Polizeiberichten, wonach die Täter in der Regel erwachsene männliche Verwandte sind." Dies scheint auf eine erhebliche Unterberichterstattung über Missbrauch bei Beamten hinzudeuten.
Nur etwa die Hälfte der Opfer von Mädchen und weniger als ein Drittel der Opfer von Jungen gaben ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch bekannt. Die Offenlegungsrate ist bei schwereren Formen des sexuellen Missbrauchs sogar noch niedriger.
Die meisten Opfer, die dies offenlegen, tun dies ihren Kollegen gegenüber. weniger als 20 Prozent für ihre Familien. Weniger als 10 Prozent der Opfer meldeten den sexuellen Missbrauch der Polizei.
„Im Vergleich zu ähnlichen Studien aus anderen Ländern sind die Offenlegungszahlen in der Schweizer Studie niedrig. Die Zurückhaltung bei der Meldung derartiger Vorfälle an Familienmitglieder oder Behörden erschwert ein rechtzeitiges Eingreifen “, sagte Schnyder.
Quelle: Universität Zürich