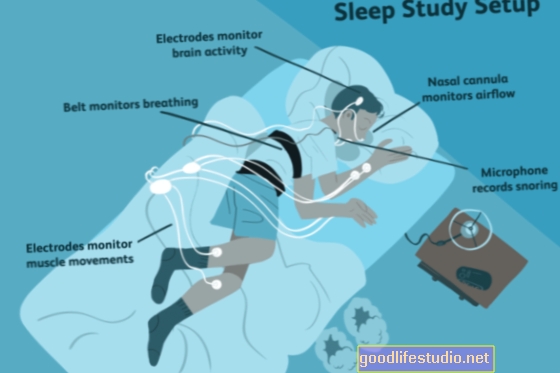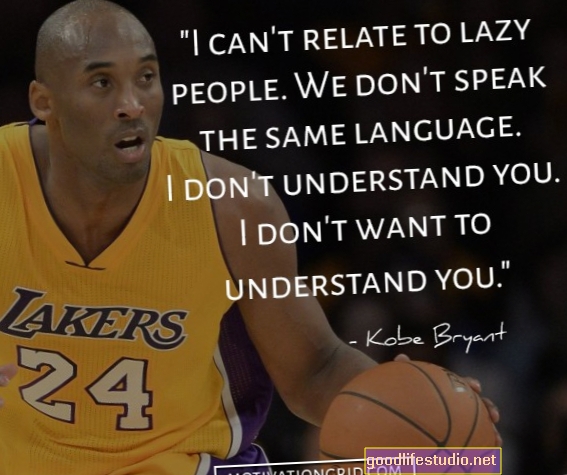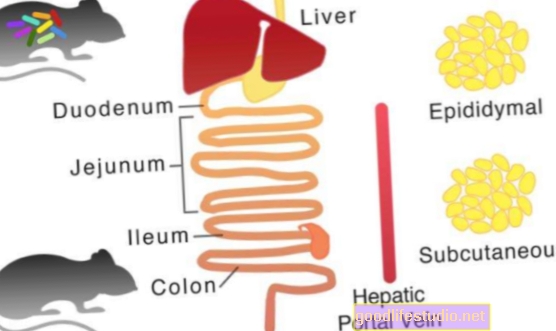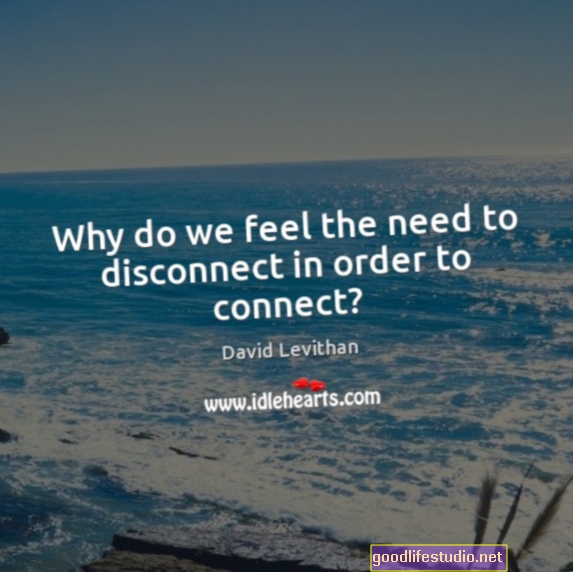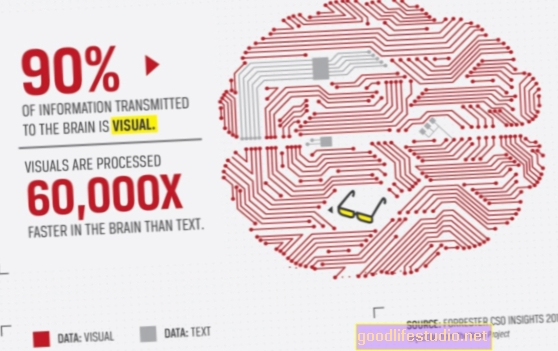Das Gehirn lindert den Schmerz der sozialen Ablehnung

Forscher der Universität von Michigan entdeckten auch, dass Menschen, die bei einem Persönlichkeitsmerkmal namens Resilienz - der Fähigkeit, sich an Umweltveränderungen anzupassen - eine hohe Punktzahl erzielen, die höchste Menge an natürlicher Schmerzmittelaktivierung aufwiesen.
Wie in der Zeitschrift veröffentlicht Molekulare PsychiatrieDie Forscher verwendeten einen innovativen Ansatz, um festzustellen, dass das natürliche Schmerzmittelsystem des Gehirns auf soziale Ablehnung reagiert - nicht nur auf körperliche Verletzungen.
Die Forscher kombinierten fortschrittliches Gehirn-Scannen, das die chemische Freisetzung im Gehirn verfolgen kann, mit einem Modell der sozialen Abstoßung, das auf Online-Dating basiert.
Die Forscher konzentrierten sich auf das Mu-Opioid-Rezeptorsystem im Gehirn - dasselbe System, das das Forscherteam seit Jahren in Bezug auf die Reaktion auf körperliche Schmerzen untersucht hat.
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Gehirn von Menschen, die körperliche Schmerzen verspüren, Chemikalien, sogenannte Opioide, in den Raum zwischen den Neuronen abgibt und so die Schmerzsignale dämpft.
David T. Hsu, Ph.D., der Hauptautor des neuen Papiers, sagt, die neue Forschung zur sozialen Ablehnung sei aus jüngsten Studien anderer hervorgegangen, die darauf hindeuten, dass die Gehirnwege, die bei körperlichen und sozialen Schmerzen aktiviert werden, ähnlich sind .
"Dies ist die erste Studie, die in das menschliche Gehirn blickt, um zu zeigen, dass das Opioidsystem während der sozialen Ablehnung aktiviert wird", sagt Hsu.
"Im Allgemeinen ist bekannt, dass Opioide während sozialer Not und Isolation bei Tieren freigesetzt werden, aber wo dies im menschlichen Gehirn auftritt, wurde bisher nicht gezeigt."
An der Studie nahmen 18 Erwachsene teil, die gebeten wurden, Fotos und fiktive persönliche Profile von Hunderten anderer Erwachsener anzusehen. Jeder wählte einige aus, an denen er romantisch am meisten interessiert sein könnte - ein Setup ähnlich dem Online-Dating.
Als die Teilnehmer dann in einem Gehirnbildgebungsgerät namens PET-Scanner lagen, wurden sie darüber informiert, dass die Personen, die sie attraktiv und interessant fanden, nicht an ihnen interessiert waren.
Während dieser Momente durchgeführte Gehirnscans zeigten eine Opioidfreisetzung, gemessen anhand der Verfügbarkeit von Mu-Opioidrezeptoren auf Gehirnzellen.
Der Effekt war am größten in den Hirnregionen, die als ventrales Striatum, Amygdala, Mittellinientalamus und periaquäduktale Grauzonen bezeichnet werden - Bereiche, von denen bekannt ist, dass sie auch an körperlichen Schmerzen beteiligt sind.
Die Forscher hatten tatsächlich im Voraus sichergestellt, dass die Teilnehmer verstanden hatten, dass die "Dating" -Profile nicht real waren und auch nicht die "Ablehnung". Die simulierte soziale Ablehnung reichte jedoch aus, um sowohl eine emotionale als auch eine opioide Reaktion hervorzurufen.
Hsu merkt an, dass die zugrunde liegende Persönlichkeit der Teilnehmer eine Rolle bei der Reaktion ihrer Opioidsysteme zu spielen schien.
"Personen, die in einem Persönlichkeitsfragebogen eine hohe Punktzahl für das Resilienzmerkmal erzielten, waren in der Regel in der Lage, während der sozialen Ablehnung, insbesondere in der Amygdala, mehr Opioide freizusetzen", sagte Hsu, eine Region des Gehirns, die an der emotionalen Verarbeitung beteiligt ist.
"Dies deutet darauf hin, dass die Opioidfreisetzung in dieser Struktur während der sozialen Ablehnung schützend oder anpassungsfähig sein kann."
Je mehr Opioide während der sozialen Abstoßung in einem anderen Hirnbereich, dem so genannten pregenualen cingulären Kortex, freigesetzt werden, desto weniger gaben die Teilnehmer an, durch die Nachricht, dass sie geschnappt wurden, schlecht gelaunt zu sein.
Die Forscher untersuchten auch, was passiert, wenn den Teilnehmern mitgeteilt wurde, dass jemand, an dem sie Interesse bekundet hatten, Interesse an ihnen bekundet hatte - soziale Akzeptanz. In diesem Fall hatten einige Gehirnregionen auch mehr Opioidfreisetzung.
"Es ist bekannt, dass das Opioidsystem sowohl bei der Schmerzreduzierung als auch bei der Förderung des Vergnügens eine Rolle spielt, und unsere Studie zeigt, dass es dies auch im sozialen Umfeld tut", sagte Hsu.
Die neue Forschung ist wichtiger als nur die reine Entdeckung, bemerken die Autoren, zu denen auch der leitende Autor Jon-Kar Zubieta, M.D., Ph.D., ein langjähriger Opioidforscher, gehört.
Die Forscher planen, ihre Studien zu erweitern, um zu untersuchen, wie diejenigen, die anfällig für Depressionen oder soziale Ängste sind oder derzeit an Depressionen leiden, eine abnormale Opioidreaktion auf soziale Ablehnung und / oder Akzeptanz haben.
„Es ist möglich, dass Menschen mit Depressionen oder sozialer Angst in Zeiten sozialer Not weniger in der Lage sind, Opioide freizusetzen, und sich daher nicht so schnell oder vollständig von einer negativen sozialen Erfahrung erholen.
"In ähnlicher Weise können diese Personen bei positiven sozialen Interaktionen auch weniger Opioide freisetzen und daher möglicherweise nicht so viel von sozialer Unterstützung profitieren", sagte Hsu.
Hsu merkt auch an, dass möglicherweise neue Opioid-Medikamente ohne Suchtpotential eine wirksame Behandlung für Depressionen und soziale Angstzustände sein können. Obwohl solche Medikamente noch nicht verfügbar sind, sagte er: "Zunehmende Evidenz für die neuronale Überlappung von physischen und sozialen Schmerzen legt eine bedeutende Gelegenheit nahe, die Forschung in der Behandlung chronischer Schmerzen mit der Behandlung psychiatrischer Störungen zu verbinden."
Wenn nichts anderes, kann das Wissen, dass unsere Reaktion auf einen sozialen Stupser nicht „alles in unseren Köpfen“ ist, einigen Menschen helfen, ihre Reaktionen zu verstehen und besser damit umzugehen, sagte Hsu. "Das Wissen, dass Chemikalien in unserem Gehirn vorhanden sind, die uns helfen, uns nach der Ablehnung besser zu fühlen, ist beruhigend."
Quelle: Gesundheitssystem der Universität von Michigan