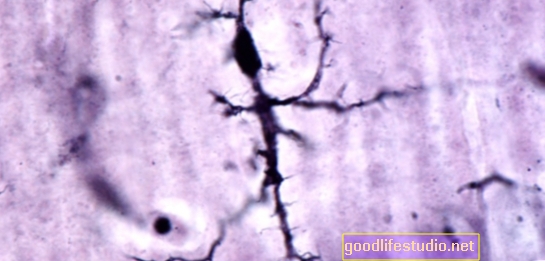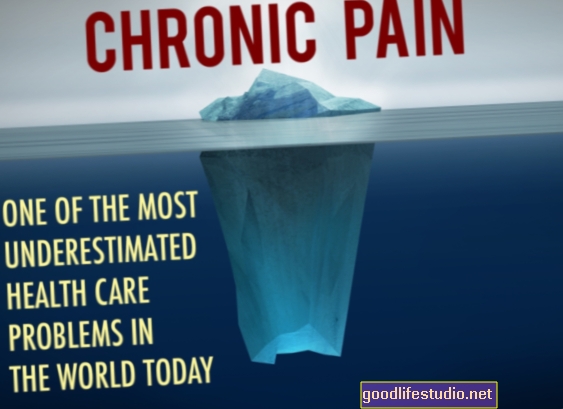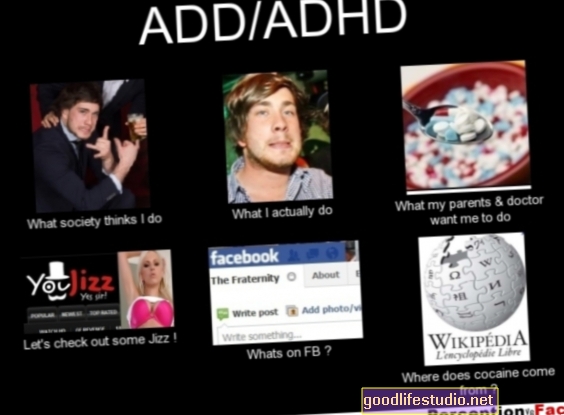Scans können den Therapieerfolg bei Depressionsangst vorhersagen
In nicht allzu ferner Zukunft könnten mithilfe von Bildgebungsscans des Gehirns vorhergesagt werden, ob eine Psychotherapie jemandem mit Depressionen oder Angstzuständen helfen wird.
Das Ergebnis stammt aus einer Überprüfung der aktuellen Forschung und veröffentlicht in der Harvard Review of Psychiatry.
Die Forscher stellten fest, dass mehrere Studien vielversprechende Beweise dafür liefern, dass bestimmte „Neuroimaging-Marker“ bei der Vorhersage der Chancen eines guten Ansprechens auf Psychotherapie - oder der Wahl zwischen Psychotherapie oder Medikamenten - bei Patienten mit Major Depression (MDD) und anderen Diagnosen hilfreich sein könnten.
"Während einige Gehirnregionen als potenzielle Kandidatenmarker aufgetaucht sind, gibt es immer noch viele Hindernisse, die ihre klinische Verwendung ausschließen", kommentiert die Hauptautorin Dr. Trisha Chakrabarty von der University of British Columbia, Vancouver.
In der Studie analysierten die Forscher frühere Forschungsergebnisse, in denen Bildgebungsscans des Gehirns ausgewertet wurden, um die Ergebnisse der Psychotherapie bei schweren Depressionen und Angststörungen vorherzusagen.
Das Thema ist wichtig, da Psychiater versuchen, Bildgebungsmarker für das Ansprechen auf eine Psychotherapie zu identifizieren, die analog oder vergleichbar mit Elektrokardiogrammen und Labortests sind, die zur Entscheidung über Behandlungen für Myokardinfarkt verwendet werden.
Die Überprüfung ergab 40 Studien, darunter Patienten mit MDD, Zwangsstörung, posttraumatischer Belastungsstörung und anderen Diagnosen. Einige Studien verwendeten strukturelle Untersuchungen zur Bildgebung des Gehirns, die die Anatomie des Gehirns zeigen. andere verwendeten funktionelle Scans, die die Gehirnaktivität demonstrieren.
Obwohl kein einzelner Hirnbereich konsistent mit dem Ansprechen auf Psychotherapie assoziiert war, identifizierten die Ergebnisse einige „Kandidatenmarker“.
Studien deuteten darauf hin, dass psychotherapeutische Reaktionen mit Aktivitäten in zwei Bereichen des tiefen Gehirns zusammenhängen könnten: der Amygdala, die an Stimmungsreaktionen und emotionalen Erinnerungen beteiligt ist; und die vordere Insula, die an der Wahrnehmung des physiologischen Zustands des Körpers, an Angstreaktionen und an Ekelgefühlen beteiligt ist.
In MDD-Studien sprachen Patienten mit höherer Aktivität in der Amygdala eher auf eine Psychotherapie an. Im Gegensatz dazu war in einigen Studien zu Angststörungen eine geringere Aktivität in der Amygdala mit besseren psychotherapeutischen Ergebnissen verbunden.
Studien zur Aktivität der vorderen Insula zeigten das Gegenteil: Das Ansprechen der Psychotherapie war mit einer höheren Vorbehandlungsaktivität bei Angststörungen und einer geringeren Aktivität bei MDD verbunden.
Andere Studien verknüpften psychotherapeutische Reaktionen mit einem frontalen Hirnbereich, dem anterioren cingulären Kortex, der eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Emotionen spielt.
Die meisten Beweise deuten darauf hin, dass MDD-Patienten mit geringerer Aktivität in einigen Teilen des ACC (ventral und subgenual) mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Ergebnisse mit Psychotherapie erzielen.
"Zukünftige Studien zum Ansprechen auf Psychotherapie könnten sich weiter auf diese einzelnen Regionen als prädiktive Marker konzentrieren", so Dr. Chakrabarty.
"Darüber hinaus könnten sich zukünftige Biomarker-Studien auf die funktionelle Konnektivität zwischen diesen Regionen vor der Behandlung konzentrieren, da die affektive Erfahrung über wechselseitige Verbindungen zwischen Gehirnbereichen wie ACC und Amygdala moduliert wird."
Die Forscher betonen die Grenzen der aktuellen Evidenz für Neuroimaging-Marker für das Ansprechen auf Psychotherapie - die Studien waren hinsichtlich ihrer Methodik und Ergebnisse sehr unterschiedlich.
Weitere Studien sind erforderlich, um zu bewerten, wie sich die potenziellen Neuroimaging-Marker im Laufe der Zeit verhalten, ob sie vorhersagen können, welche Patienten im Vergleich zur Psychotherapie besser auf Medikamente ansprechen und wie sie in klinische Merkmale integriert werden können, um die Ergebnisse für Patienten mit Depressionen und Angststörungen zu verbessern .
Quelle: Wolters Kluwer Health / EurekAlert