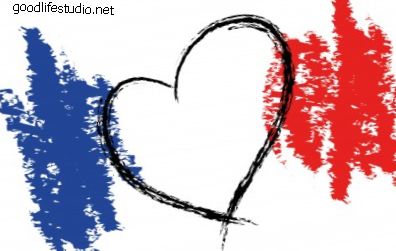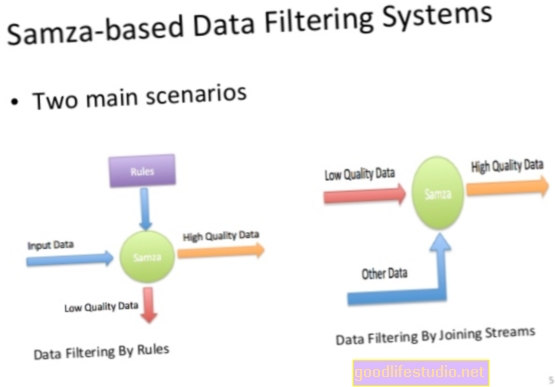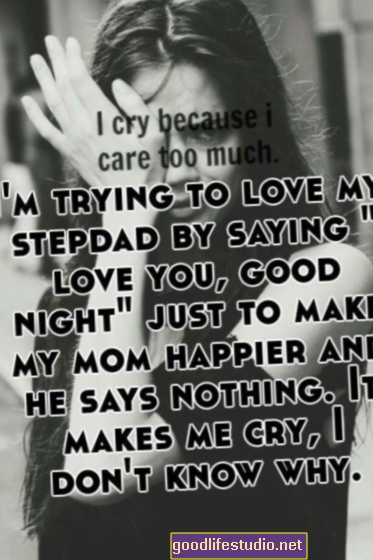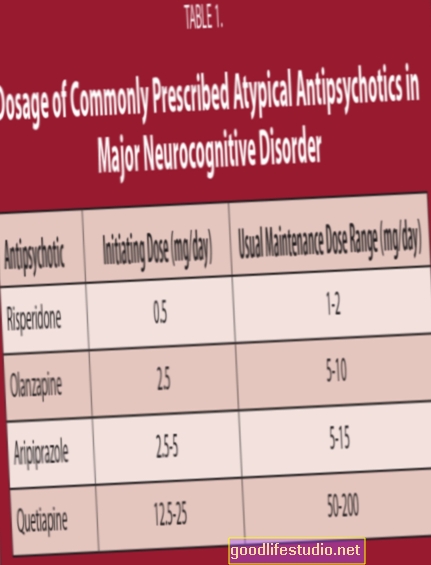Depressionspflege durch kulturelles Stigma verlangsamt
Eine Studie stellt fest, dass eine angemessene psychische Versorgung durch die kulturelle Ausrichtung eines Einzelnen behindert wird.
Das Nichterkennen oder Erkennen von psychischen Erkrankungen behindert ein angemessenes Krankheitsmanagement und umfasst Verhaltensweisen wie die Nichteinhaltung von Medikamentenschemata und die Nichteinhaltung geplanter Termine.
Die Ergebnisse könnten Ärzten helfen, eine Reihe von Fragen an Identitätspatienten zu entwickeln, die möglicherweise besonders pflegeresistent sind, und ihnen dann helfen, die Funktionsweise der Behandlung zu verstehen, sagte der leitende Studienautor William Vega.
"Leider stellt sich das Stigma der psychischen Gesundheit als eines der schwerwiegendsten Hindernisse für Menschen heraus, die Pflege erhalten oder in Pflege bleiben", sagte Vega, Professor für Medizin und Sozialarbeit an der University of Southern California.
Viele Kulturen haben Stereotypen über Depressionen und psychische Erkrankungen, sagte er, und einige sehen darin etwas, das eine Familie für Generationen prägen wird.
Insbesondere Latinos legen Wert auf Belastbarkeit und denken: "Es ist ein kultureller Wert, in der Lage zu sein, Ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln", sagte er. "Wenn du nicht kannst, bedeutet das, dass du schwach bist."
Während es nicht verwunderlich sein mag, dass Latinos psychische Erkrankungen stigmatisieren, "wie bei vielen Dingen sind es nur Anekdoten und Anspielungen, bis Sie etwas Solideres tun, wie eine Forschungsstudie, und herausfinden, worum es geht", sagte Vega, der daran arbeitete die Studie mit Kollegen an der University of California in Los Angeles.
In der neuen Studie, veröffentlicht in der März / April-Ausgabe der Zeitschrift Allgemeine KrankenhauspsychiatrieForscher befragten 200 arme spanischsprachige Latinos in Los Angeles. Sie alle hatten örtliche Grundversorgungszentren besucht; 83 Prozent waren Frauen. Alle hatten bei einem ersten Screening Anzeichen einer Depression gezeigt.
Ein weiteres Screening ergab, dass alle bis auf 54 der 200 Personen leicht bis schwer depressiv waren. Die Forscher betrachteten 51 Prozent als diejenigen, die psychische Erkrankungen stigmatisieren, basierend auf Antworten auf Fragen zu Dingen wie der Vertrauenswürdigkeit einer depressiven Person.
Die Forscher fanden heraus, dass diejenigen, die psychische Erkrankungen stigmatisierten, 22 Prozent weniger dazu neigten, Depressionsmedikamente einzunehmen, 21 Prozent weniger wahrscheinlich in der Lage waren, ihre Depression zu kontrollieren, und etwa 44 Prozent häufiger geplante Termine für psychische Gesundheit verpasst hatten.
Die Ergebnisse "zeigen Beweise dafür, dass Stigmatisierung besteht, und sie beziehen sich auf Dinge, die im Rahmen einer angemessenen Behandlung wichtig sind", sagte Vega.
Jamie Walkup, ein außerordentlicher Professor für Psychologie an der Rutgers University, der sich mit psychischer Gesundheit und Stigmatisierung befasst, sagte, der Schlüssel bestehe darin, Wege zu finden, um „gegen diese negativen Ideen vorzugehen, in der Hoffnung, dass eine Person mit Depressionen keine Abneigung mehr gegen eine Person mit Depressionen zulässt Depressionen hindern sie daran, das zu tun, was sie möglicherweise tun müssen, um Hilfe zu erhalten. “
Es könnte sich lohnen zu fragen, sagte er, "ob es manchmal sinnvoller ist, mit einem Patienten zu schalten, der es aus irgendeinem Grund unerträglich findet, sich selbst als depressiv zu betrachten."
In solchen Fällen könnten Ärzte andere Wege finden, um mit diesen Patienten zu arbeiten, ohne darauf zu bestehen, dass sie ihre Diagnose anerkennen.
Quelle: Health Behavior News Service