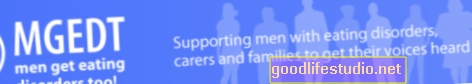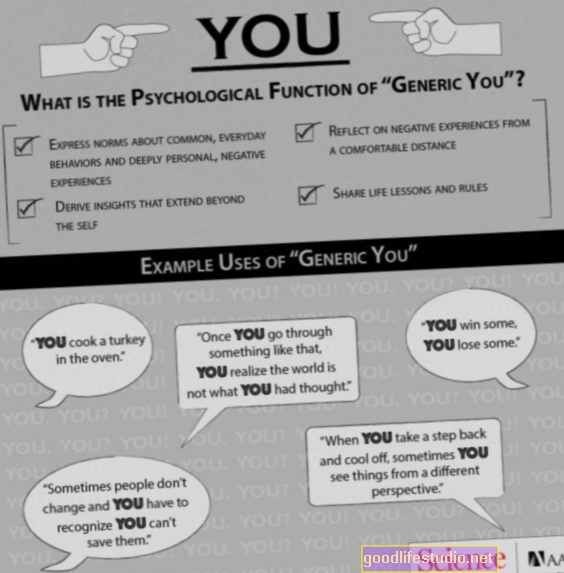Kann Religion oder Spiritualität helfen, Depressionen abzuwehren?


Viele Menschen schwören auf bestimmte Dinge, um Depressionen fernzuhalten. Einige Menschen trainieren, während andere sich mehr in ihre Arbeit stürzen. Andere nehmen eine tägliche Dosis eines Krauts wie Johanniskraut oder Fischöl ein, da diese Inhaltsstoffe in einigen Studien einen Zusammenhang mit einer Verringerung der Depression hatten.
Aber was ist mit Religion? Kann ein starker Sinn für Spiritualität oder Religion Ihnen helfen, Depressionen abzuwehren?
Laut einer neuen Studie, die einer Gruppe von Menschen über 10 Jahre folgte, lautet die Antwort ein qualifiziertes „Ja“.
Die neue Längsschnittforschung der Columbia University wollte an frühere Forschungen anknüpfen, die diesen Zusammenhang zwischen Spiritualität oder Religiosität und einem verringerten Risiko für Depressionen belegen.
Die Forscher verfolgten weiterhin eine Reihe von Themen, die sie in der vorherigen Studie verwendet hatten, von der 10-Jahres-Marke (als die ältere Forschung beendet war) bis zur 20-Jahres-Marke. Die Probanden in der Studie waren 114 erwachsene Nachkommen sowohl von depressiven Eltern als auch von Eltern, die keine Depression hatten.
Anschließend bewerteten sie die Diagnose und Religiosität / Spiritualität jeder Person:
Die Diagnose wurde anhand des Zeitplans für affektive Störungen und der Schizophrenie-Lebenszeit-Version bewertet. Zu den Religiositätsmaßnahmen gehörten die persönliche Bedeutung von Religion oder Spiritualität, die Häufigkeit der Teilnahme an Gottesdiensten und die Konfession (alle Teilnehmer waren katholisch oder protestantisch).
Die Diagnose einer schweren Depression nach 20 Jahren wurde nach Angaben der Forscher als Ergebnismaß verwendet. Die drei Religiositätsvariablen nach 10 Jahren wurden als Prädiktoren verwendet.
Was haben sie nach 10 Jahren gefunden?
Diejenigen Probanden, die zu Beginn der Studie berichtet hatten, dass „Religion oder Spiritualität für sie sehr wichtig sind, hatten im Vergleich zu anderen Teilnehmern etwa ein Viertel des Risikos einer schweren Depression zwischen den Jahren 10 und 20“.
Aber hier ist der wahre Kicker - es waren nicht unbedingt die biblischen Kirchenbesucher, die dieses reduzierte Risiko hatten. Weder die Anzahl der Gottesdienste noch die spezifische religiöse Diagnose sagten das Ergebnis voraus.
Diejenigen mit dem höchsten Risiko für Depressionen, weil sie das Kind eines depressiven Elternteils waren (die genetische und ökologische Verbindung, die für die Bestimmung des Depressionsrisikos wichtig ist), hatten aufgrund ihrer Spiritualität oder religiösen Natur das größte Risiko.
[I] In dieser Gruppe hatten diejenigen, die von einer hohen Bedeutung von Religion oder Spiritualität berichteten, etwa ein Zehntel des Risikos einer schweren Depression zwischen den Jahren 10 und 20 im Vergleich zu denen, die dies nicht taten. Die Schutzwirkung wurde hauptsächlich gegen ein Wiederauftreten und nicht gegen das Einsetzen einer Depression festgestellt.
Nach dieser Längsschnittuntersuchung scheinen Spiritualität oder Religion eine schützende Wirkung vor allem gegen das Wiederauftreten von Depressionen zu haben. In einigen Fällen kann es auch vor dem Auftreten von Depressionen schützen. Dieser Effekt war am stärksten bei denen, deren ein oder mehrere Elternteile ebenfalls an Depressionen litten.
Da es sich um eine Folgestudie an denselben Teilnehmern handelte, die bereits in früheren Untersuchungen denselben Effekt gezeigt hatten, müssen wir dennoch vorsichtig sein, wenn wir zu weitreichende Schlussfolgerungen ziehen. Es kann sein, dass diese Gruppe nicht vielfältig genug oder repräsentativ für die Bevölkerung war oder eine Reihe einzigartiger Merkmale aufwies, die die Generalisierbarkeit der Ergebnisse noch interpretationsfähig machen.
Referenz
Miller et al. (2011). Religiosität und schwere Depression bei Erwachsenen mit hohem Risiko: Eine zehnjährige prospektive Studie. American Journal of Psychiatry. doi: 10.1176 / appi.ajp.2011.10121823