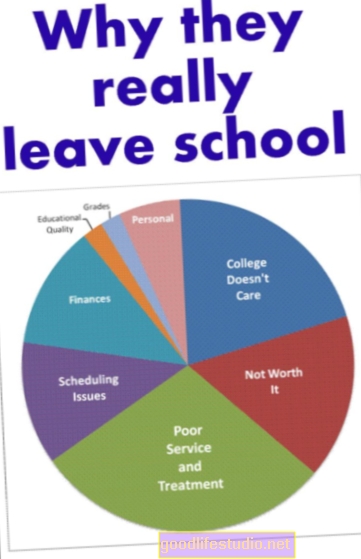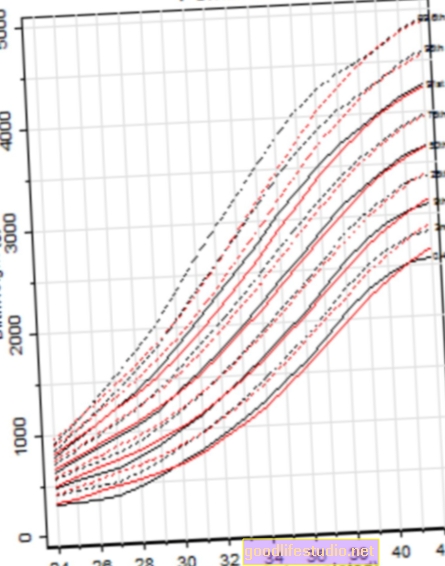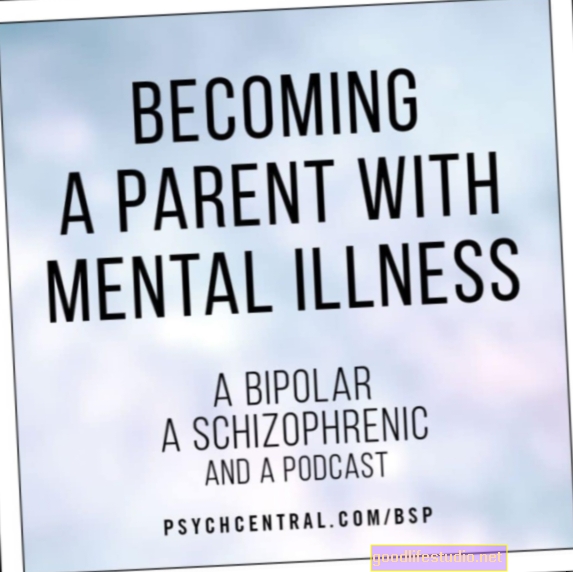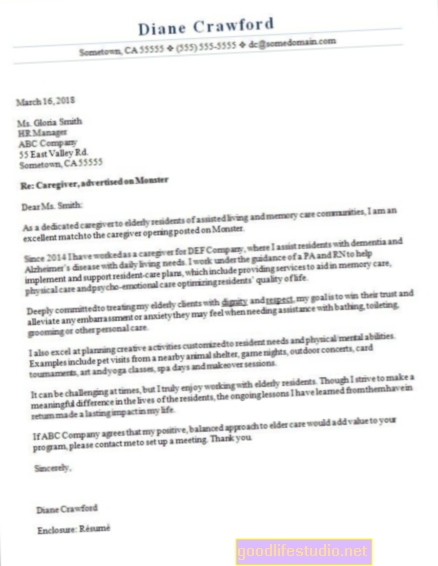Studie deckt Risikofaktoren auf, die mit einer Überdosierung von Opioiden nach der Geburt zusammenhängen
In einer neuen Studie in der Zeitschrift veröffentlicht SuchtForscher aus Massachusetts decken mehrere Risikofaktoren auf, die mit einer Überdosierung von Opioiden nach der Geburt zusammenhängen.
Die Studie ist eine Folgestudie aus dem Jahr 2018, die zeigt, dass die Überdosierungsraten von Opioiden im Verlauf der Schwangerschaft tendenziell sinken, nach der Geburt jedoch signifikant ansteigen.
Für die Studie untersuchten die Forscher die Krankengeschichte von etwa 175.000 Frauen im Jahr vor und im Jahr nach der Entbindung von Babys in Massachusetts und identifizierten 189, die mindestens eine Überdosis Opioid nach der Geburt hatten.
Zu den Risikofaktoren, die mit einer Überdosierung von Opioiden nach der Geburt verbunden sind, gehören eine Überdosierung in der Vorgeschichte während der Schwangerschaft, die Diagnose einer Opioidkonsumstörung (OUD), ein Opioidentzug bei Neugeborenen und eine überdurchschnittliche Notfallversorgung im Jahr vor der Geburt.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis war, dass OUD, gemessen an einem Versicherungsanspruch im Jahr vor der Geburt, nur in 46,6 Prozent der Fälle identifiziert wurde.
Dies deutet darauf hin, dass der diagnostische Anspruch von OUD im Datensatz möglicherweise nicht ausreichend angegeben wurde oder dass einige Frauen während der Schwangerschaft nicht auf OUD untersucht wurden, Angst hatten, ihre Störung des Substanzkonsums ihrem vorgeburtlichen Versorger mitzuteilen, oder nach der Entbindung mit der Verwendung von Substanzen begannen .
"Die Zeit nach der Geburt ist eine gefährdete Zeit für Frauen, in der ihre gesundheitlichen Bedürfnisse häufig nicht berücksichtigt werden", sagte Dr. Davida M. Schiff von der Abteilung für allgemeine akademische Pädiatrie des Massachusetts General Hospital (MGH) und leitende Autorin der Studie.
"Wir haben die Möglichkeit, dieses Screening bei Kinderärzten, Hausbesuchsprogrammen und Frühinterventionsanbietern, die häufig mit Frauen und Familien nach der Geburt interagieren, zu einer Priorität zu machen, genauso wie wir nach postpartalen Stimmungsstörungen suchen", sagte sie.
Sie fügte hinzu, dass nach dem Screening unterstützende, nicht strafende Systeme vorhanden sein müssen, um den behandlungsbedürftigen Familien zu helfen.
"Es reicht nicht aus, nur zu screenen", sagte Schiff. "Wir müssen die Art von unterstützender Pflege, die wir für jedes andere chronische Gesundheitsproblem benötigen, besser leisten."
Unter den Frauen, bei denen keine OUD diagnostiziert wurde, waren andere Faktoren, die positiv mit einer Überdosierung nach der Geburt verbunden waren, die weiße nicht-hispanische Rasse, unverheiratet zu sein, eine öffentliche Versicherung zu haben, per Kaiserschnitt zu entbinden, an öffentlich finanzierten Suchtbehandlungsprogrammen teilzunehmen, Inhaftierung und Säugling Frühgeburt oder Geburt mit niedrigem Geburtsgewicht.
"Wir haben festgestellt, dass die Rate tödlicher und nicht tödlicher Überdosierungen nach der Geburt ungewöhnlich ist, aber bestimmte Frauen sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt", sagte der Hauptautor Timothy Nielsen, MPH, Doktorand an der Universität von Sydney und ehemaliger Epidemiologiestipendiat am Massachusetts Department der öffentlichen Gesundheit.
"Angesichts der erheblichen Morbidität im Zusammenhang mit einer Überdosierung mit Opioiden sollten wir unser Bestes tun, um die am stärksten gefährdeten Mütter im Jahr nach der Entbindung zu unterstützen."
Ein einzigartiger Datensatz ermöglichte diese Studie. Im Jahr 2015 hat das Gesundheitsministerium von Massachusetts landesweite Ressourcen wie Entlassungsdaten von Krankenhäusern, Krankenwagen-Reiseberichte, Geburts- und Sterbeurkunden sowie Daten zur Suchtbehandlung verknüpft und so eine Vielzahl von Datenquellen erstellt, die mehrere Faktoren veranschaulichen, die zur Überdosierung nach der Geburt beitragen.
"Daten aus unserem innovativen Public Health Data Warehouse haben es uns ermöglicht, ein tieferes Verständnis der Opioidkrise zu erlangen und unsere Ressourcen besser zu nutzen", sagte Monica Bharel, MD, MPH, Mitautorin des Papiers. "Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für unseren datengesteuerten Ansatz zur Bekämpfung der Epidemie, da er sich auf die Gesundheit von Müttern, Babys und Familien auswirkt."
Quelle: Massachusetts General Hospital