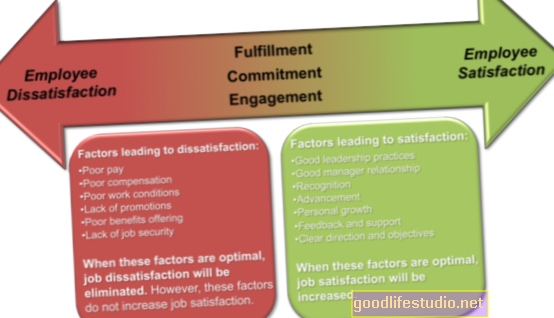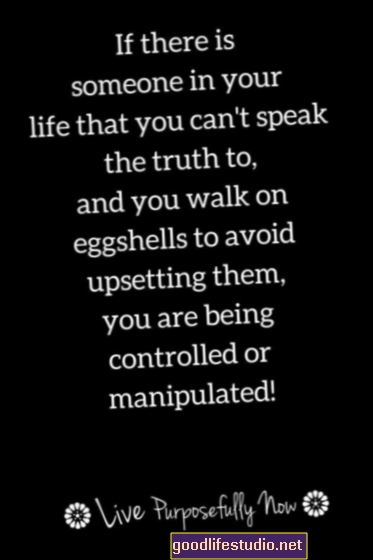Die Verwendung von Antidepressiva während der Schwangerschaft erhöht das Risiko für Nachkommen, aber auch die Vererbung
Eine neue niederländische Studie zeigt, dass der mütterliche Gebrauch von Antidepressiva während der Schwangerschaft das Risiko zu erhöhen scheint, dass das Kind ein psychisches Problem entwickelt. Das Risiko für Erkrankungen wie Autismus, Depressionen, Angstzustände und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist erhöht.
Die Ermittler sind sich jedoch nicht sicher, welche Rolle das Erbgut als Teil des erhöhten Risikos spielt. Darüber hinaus kann eine unbehandelte schwere Depression während der Schwangerschaft zu negativen Ergebnissen für Mutter und Kind führen.
Experten erkennen an, dass der Einsatz von Antidepressiva bei schwangeren Frauen seit vielen Jahren auf dem Vormarsch ist. Derzeit nehmen zwischen zwei und acht Prozent der schwangeren Frauen Antidepressiva ein.
In der neuen Studie zeigen Forscher des Nationalen Zentrums für registrierungsbasierte Forschung in Aarhus BSS, dass ein erhöhtes Risiko bei der Verwendung von Antidepressiva während der Schwangerschaft besteht.
Die Forscher unter der Leitung von Xiaoqin Liu haben registrierungsbasierte Untersuchungen zur Untersuchung von 905.383 Kindern durchgeführt, die zwischen 1998 und 2012 geboren wurden, um die möglichen nachteiligen Auswirkungen des Einsatzes von Antidepressiva durch die Mutter während ihrer Schwangerschaft zu untersuchen.
Sie fanden heraus, dass von den insgesamt 905.383 Kindern 32.400 später im Leben eine psychiatrische Störung entwickelten. Einige dieser Kinder wurden von Müttern geboren, die während ihrer Schwangerschaft Antidepressiva erhielten, während andere Kinder keinen Medikamenten ausgesetzt waren.
„Wenn wir uns Kinder ansehen, die von Müttern geboren wurden, die die Behandlung mit Antidepressiva während der Schwangerschaft abgebrochen und fortgesetzt haben, können wir ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer psychiatrischen Störung feststellen, wenn die Mütter die Behandlung mit Antidepressiva während der Schwangerschaft fortsetzen“, sagt Xiaoqin Liu.
Liu ist der Hauptautor des Artikels, der in der BMJ-British Medical Journal.
Die Forscher teilten die Kinder in vier Gruppen ein, abhängig davon, ob die Mutter vor und während der Schwangerschaft Antidepressiva verwendet.
Die Kinder der ersten Gruppe waren im Mutterleib keinen Antidepressiva ausgesetzt gewesen. In Gruppe zwei hatten die Mütter bis zur Schwangerschaft Antidepressiva eingenommen, jedoch nicht während der Schwangerschaft. In Gruppe drei verwendeten die Mütter sowohl vor als auch während der Schwangerschaft Antidepressiva. Gruppe vier bestand aus Kindern, deren Mütter neue Antidepressiva konsumierten und die während der Schwangerschaft mit der Einnahme der Medikamente begonnen hatten.
Das Ergebnis der Studie zeigte eine erhöhte Anzahl von Kindern mit psychischen Störungen in der Gruppe, in der die Mütter während ihrer Schwangerschaft Antidepressiva verwendet hatten.
Ungefähr doppelt so viele Kinder wurden in Gruppe vier (14,5 Prozent) mit einer psychiatrischen Störung diagnostiziert wie in Gruppe eins (acht Prozent). In den Gruppen zwei und drei wurde bei 11,5 Prozent und 13,6 Prozent im Alter von 16 Jahren eine psychiatrische Störung diagnostiziert.
Trotz des offensichtlichen Zusammenhangs mit Medikamenten stellen Forscher schnell fest, dass psychiatrische Störungen erblich sind.
Daher berücksichtigten die Ermittler, dass die Erblichkeit auch eine Rolle bei der Bestimmung spielt, bei wem eine psychiatrische Störung diagnostiziert wird, und dass es nicht nur darum geht, im Mutterleib Antidepressiva ausgesetzt zu sein.
„Wir haben uns entschieden, die Studie unter der Annahme durchzuführen, dass psychiatrische Störungen in hohem Maße vererbbar sind. Aus diesem Grund wollten wir zeigen, dass dies zu eng ist, wenn man nur Autismus betrachtet, wie es viele frühere Studien getan haben.
Wenn die Erblichkeit eine Rolle spielt, erscheinen in den Daten auch andere psychiatrische Störungen wie Depressionen, Angstzustände und ADHS-ähnliche Symptome “, sagt Trine Munk-Olsen, die auch eine der Forscherinnen hinter der Studie ist.
In der Tat zeigt die Studie auch, dass der Anstieg nicht nur Autismus, sondern auch andere psychiatrische Störungen wie Depressionen, Angstzustände und ADHS abdeckt.
Somit wird klar, dass die zugrunde liegende psychiatrische Störung der Mutter im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit des Kindes im späteren Leben von Bedeutung ist. Gleichzeitig kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Einsatz von Antidepressiva das Risiko für psychiatrische Erkrankungen des Kindes weiter erhöht.
"Unsere Forschung zeigt, dass Medikamente das Risiko zu erhöhen scheinen, aber dass auch die Erblichkeit eine Rolle spielt", sagt Trine Munk-Olsen, die auch darauf hinweist, dass es möglicherweise die Mütter sind, die an den schwersten Formen der Depression leiden, die sie einnehmen müssen Medikamente während ihrer Schwangerschaft.
Die Ergebnisse sind trübe. In der Tat hoffen die Forscher, dass die Studie den Fokus auf die Tatsache erhöhen kann, dass die Forschungsergebnisse nicht nur schwarz und weiß sind.
Dies könnte Ärzten helfen, Frauen vor und nach ihrer Schwangerschaft über den Einsatz von Antidepressiva zu beraten. Einige Frauen können möglicherweise die Behandlung mit dem Medikament während der Schwangerschaft abbrechen.
Die Forscher erkennen jedoch auch an, dass einige Frauen Medikamente benötigen und betonen, dass die Folgen einer unbehandelten Depression schwerwiegend sind und schwerwiegende Folgen für Mutter und Kind haben können.
Die wichtigste Botschaft ist, dass wir das psychische Wohlbefinden der schwangeren Frauen sicherstellen und schützen. Bei einigen Frauen bedeutet dies den Einsatz von Antidepressiva.
„Diese Frauen sollten sich wegen der Einnahme von Antidepressiva nicht schuldig fühlen. Obwohl ein erhöhtes Risiko besteht, dass das Kind später im Leben eine psychiatrische Störung entwickelt, zeigen unsere Untersuchungen, dass wir Medikamente nicht allein beschuldigen können. Auch die Erblichkeit spielt eine Rolle “, sagt Trine Munk-Olsen.
Quelle: Universität Aarhus










.jpg)