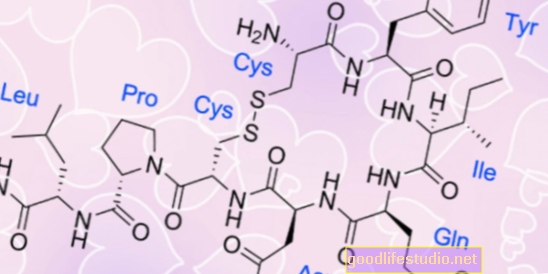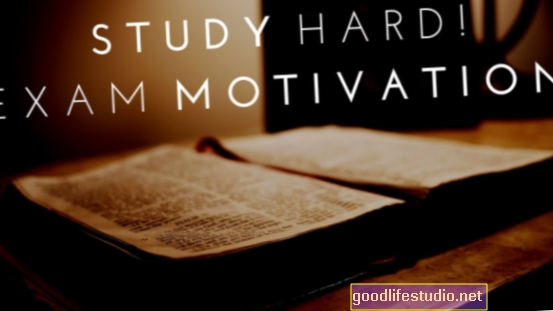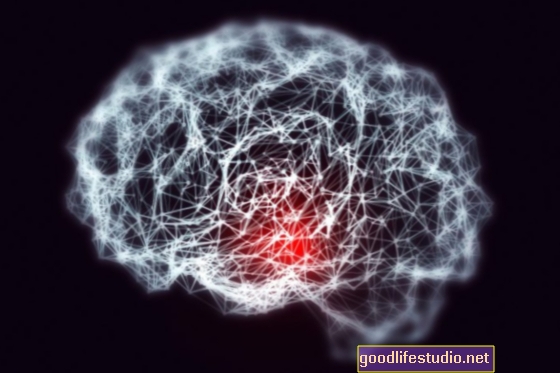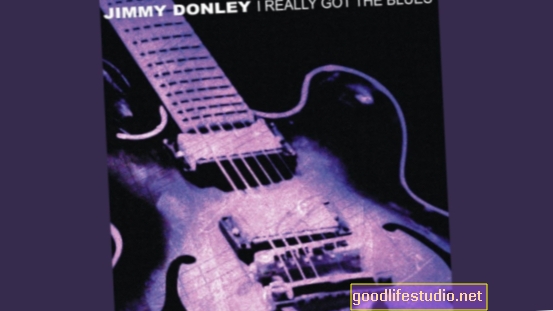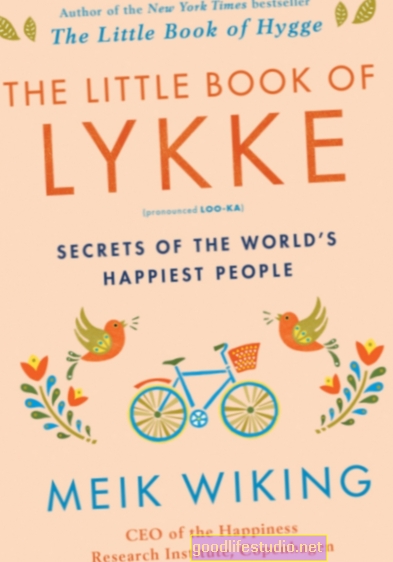Bremners falsche Behauptungen über postpartale Depressionen


Das Problem dabei ist die Einstellung, dass Mutter sein ein Risikofaktor für eine psychiatrische Störung ist. Erstens gibt es keine Hinweise darauf, dass Frauen ohne Angstzustände und Depressionen in der Vorgeschichte ein erhöhtes Risiko für eine postpartale Depression haben. Es ist also lächerlich, alle Mütter so zu untersuchen, als wäre die Geburt ein Risikofaktor für Depressionen.
Mein BS-Alarm wird immer dann ausgelöst, wenn jemand versucht, das Argument von einer angemessenen Anstrengung zur Verbesserung der Aufklärung und Information über ein stigmatisiertes Problem der psychischen Gesundheit in eine Übertreibung umzuwandeln, was darauf hindeutet, dass ein Gesetz versucht, die Mutterschaft in eine psychiatrische Störung umzuwandeln. Es geht wieder los, wenn ein Fachmann eine außergewöhnliche Behauptung aufstellt wie: "Es gibt keine Beweise dafür, dass Frauen ohne Vorgeschichte von Angstzuständen und Depressionen ein erhöhtes Risiko haben, an einer postpartalen Depression zu erkranken." "Ja wirklich?" Absolut keine Beweise? Das ist eine ziemlich starke Aussage und kann bei einer Literaturübersicht leicht als falsch erwiesen werden.
Wo sollen wir anfangen? (Ich habe nur begrenzten Platz und Sie haben eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, daher möchte ich nur einige Studien hervorheben ...)
Ross & Dennis (2009) stellten beispielsweise in einer Literaturübersicht fest, dass sowohl der Substanzkonsum als auch aktuelle oder frühere Missbrauchserfahrungen mit einem erhöhten Risiko für eine postpartale Depression (PPD) verbunden sind.
Bei städtischen südafrikanischen Frauen stellten Ramchandani und Kollegen (2009) fest, dass die stärksten Prädiktoren für postnatale Depressionen die Exposition gegenüber extremen gesellschaftlichen Stressfaktoren (z. B. Zeuge eines Gewaltverbrechens / Todesgefahr) und die Meldung von Schwierigkeiten mit ihrem Partner waren.
Robertson et al. (2004) fanden in einer großen Metaanalyse der bisherigen Forschung heraus, dass eine Vorgeschichte von Depressionen und Angstzuständen (nicht nur während der Schwangerschaft) eine postpartale Depression vorhersagte. Sie stellten jedoch auch fest, dass das bloße Erleben eines stressigen Lebensereignisses während der Schwangerschaft oder ein geringes Maß an sozialer Unterstützung (z. B. keine emotionale Unterstützung durch Ihre Freunde oder Familie) auch zu einer postpartalen Depression führen kann.
Becks (2001) Metaanalyse von 84 Studien ergab:
13 signifikante Prädiktoren für postpartale Depressionen: vorgeburtliche Depression, Selbstwertgefühl, Stress bei der Kinderbetreuung, vorgeburtliche Angst, Lebensstress, soziale Unterstützung, eheliche Beziehungen, Depressionsgeschichte, Säuglingstemperament, Mutterschaftsblau, Familienstand, SES und ungeplante / ungewollte Schwangerschaft. 10 der 13 Risikofaktoren hatten moderate Effektgrößen, während 3 Prädiktoren kleine Effektgrößen hatten.
Schauen Sie sich all diese Faktoren an, bei denen es sich nicht um Depressionen oder Angstzustände handelt - ich zähle 9. Auch wenn 3 davon Faktoren mit geringer Effektgröße sind, bleiben noch 6 Faktoren übrig, die keine Depressionen oder Angstzustände sind.
Was ist mit dem Argument, dass wir uns einfach auf sie konzentrieren sollten, wenn depressive Frauen am stärksten gefährdet sind?
Ingram & Taylor (2007) stellten fest, dass nicht nur der Schweregrad der Depression vor der Geburt einer Frau wichtig war - schlechte emotionale Unterstützung und Frauen, die ihre eigene Kindheit negativer beschrieben hatten, waren zusätzliche Risikofaktoren, die zu einem erhöhten Risiko für die Geburt beitrugen Depression. Wer wird nach diesen Dingen suchen, der Geburtshelfer?
Nein, denn der Geburtshelfer leistet bereits bei Frauen mit hohem Risiko keine gute Arbeit beim Screening auf postpartale Depressionen. Hatton et al. (2007) stellten fest, dass geburtshilfliche Anbieter bei Frauen mit hohem Risiko möglicherweise bis zu einem Fünftel der Frauen mit derzeit schwerer Depression übersehen. Nicht gerade große Zahlen dort. Wenn Geburtshelfer die offensichtlichen Fälle nicht behandeln können, kann ich mir nur vorstellen, wie gut sie mit den komplexeren oder weniger offensichtlichen Fällen umgehen.
Monk et al. (2008) fasst den Stand unseres Wissens über PPD zusammen:
Depressionen sind während der Perinatalperiode relativ häufig (Gavin et al. 2005; Ross und McLean 2006). Ungefähr 8,5–11% der Frauen leiden während der Schwangerschaft an einer schweren oder leichten Depression (Gaynes et al. 2005). Fast 20% der Frauen haben in den ersten 3 Monaten nach der Entbindung eine leichte oder schwere Depression (Gavin et al. 2005).
Bis zu 1 von 5 Frauen leiden nach der Geburt an Depressionen. Ist dies nicht erwähnenswert? (Zum Vergleich: Jeder zehnte Mann und jede zehnte Frau in der Allgemeinbevölkerung kann zu einem bestimmten Zeitpunkt an Depressionen leiden.) Wenn Sie ein Kind zur Welt bringen, verdoppelt sich Ihr Depressionsrisiko, und dies ist kein Problem? Tolle.
Aber nimm nicht nur mein Wort dafür. Die Studie von Zajicek-Farber (2009) an Hochrisikofrauen für postpartale Depressionen ergab Folgendes:
Diese Ergebnisse liefern zusätzliche unterstützende Beweise dafür, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um die depressiven Symptome von Frauen zu identifizieren und zu bewerten, um die Gesundheit und Sicherheit von Kleinkindern zu fördern.
Dies sind objektive Forscher, die mehr Screenings fordern. Keine Politiker. Und nicht Menschen (oder Fachleute) mit einer politischen Agenda.
Jetzt verstehe ich Bremners Punkt - lasst uns nicht medizinisieren und katastrophal gewöhnliche Mutterschaft. Genau. Und natürlich korreliert die Depression oder Angst einer Frau vor der Geburt stark mit der postpartalen Depression. Aber nicht ausschließlich, wie Bremner behauptet.
Bremner behauptet ohne Beweise, dass alle psychischen Vorsorgeuntersuchungen lediglich pharmazeutische Verkaufstaktiken sind, um die Verschreibungen zu erhöhen. Das ist lächerlich. Als ich in der kommunalen psychischen Gesundheit arbeitete, führten wir in der Klinik jährliche Screenings zur psychischen Gesundheit durch - ohne finanzielle Unterstützung eines Pharmaunternehmens -, da dies Stigmatisierung verringert, Fehlinformationen verringert und die Aufklärung über psychische Gesundheitsprobleme in der Allgemeinbevölkerung verbessert.
Tut mir leid, aber die meisten Menschen haben keine Zeit, sich mit einem Dutzend Blogs zu beschäftigen oder monatliche Zeitschriften über die neuesten Forschungsergebnisse zur psychischen Gesundheit zu lesen. Die meisten Menschen wissen, was sie über psychische Gesundheit wissen, größtenteils durch Mainstream-Medien oder ihre eigenen Erfahrungen aus erster Hand mit einem Problem. Wie ist die Förderung von mehr Information und Aufklärung über psychische Gesundheitsprobleme eine schlechte Sache?
Bremner verwendet Teenager als Beispiel für ein falsches Screening, erwähnt jedoch die Fakten über Teenager und die psychische Gesundheit nicht. Jugendliche sind eine „gefährdete“ Bevölkerung, weshalb sie manchmal für Screenings ausgewählt werden. Jugendliche sind dafür berüchtigt, dass sie in ihren Behandlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind (insbesondere in den USA, wo ihre Behandlung möglicherweise von der Krankenversicherung ihrer Familie abgedeckt wird, was bedeutet, dass sie mit ihren Eltern über ihre psychischen Gesundheitsprobleme sprechen) und dass Gruppenzwang ihre Akzeptanz einschränkt oder Hilfe suchen. (Ja, tut mir leid, wenn Sie als Teenager einen Therapeuten für Depressionen sehen, werden Sie normalerweise nicht als "cooles" Kind angesehen.)
Leider sind Mütter eine weitere „gefährdete“ Bevölkerung, unabhängig davon, ob die Menschen dies zugeben wollen oder nicht. Warum? Weil die Gesellschaft den Müttern immer wieder gesagt hat, dass die Geburt ein freudiger, glücklicher Anlass sein soll. Wenn Sie nach der Geburt eines Kindes depressiv sind, muss etwas mit Ihnen nicht stimmen. Machen Sie nicht auf sich selbst oder Ihre Probleme aufmerksam. Versuchen Sie einfach, damit umzugehen, versuchen Sie, auf das Baby aufzupassen, und schaffen Sie es jeden Tag. Mütter wissen nicht, dass sie möglicherweise etwas haben, das als postpartale Depression erkannt wird, geschweige denn, dass sie mit jemandem über diese Gefühle sprechen können oder dass eine Behandlung - Psychotherapie oder Medikamente - dafür verfügbar ist.
Daher bin ich mit Bremners Einschätzung des MUTTERGESETZES und seiner Notwendigkeit in der heutigen Gesellschaft nicht einverstanden. Und wenn Sie sich nicht die Mühe machen, die Beinarbeit zu erledigen und nur allgemeine (falsche) Aussagen darüber zu machen, was die Forschung tatsächlich zeigt (oder schlimmer noch, schlagen Sie vor, dass alle Forschungen, die nicht mit Ihnen übereinstimmen, in der Tasche der Pharmaindustrie sein müssen), dann ist das faul Argument der Person. Es gibt hier zu viele logische Irrtümer, um sie aufzulisten, daher möchte ich nur vorschlagen, dass ich mehr begründete und professionelle Argumente - basierend auf der tatsächlichen Forschung - über solch wichtige Gesetze erwarte.
Psych Central unterstützt weiterhin das Melanie Blocker Stokes MOTHERS Act, da die Forschung zeigt, dass es bei den Bemühungen helfen würde, die Bildung zu verbessern und Fehlinformationen über postpartale Depressionen zu korrigieren.
Verweise:
Beck, C.T. (2001). Prädiktoren für eine postpartale Depression: Ein Update. Nursing Research, 50 (5), 275 & ndash; 285.
Hatton, D. C., Harrison-Hohner, J., Matarazzo, J., E. P., Lewy, A. & Davis .L. (2007). Fehlende vorgeburtliche Depression bei Frauen mit hohem Risiko: Eine Sekundäranalyse. Archiv für psychische Gesundheit von Frauen, 10 (3), 121-123.
Ingram, J. & Taylor, J. (2007). Prädiktoren für postnatale Depressionen: Verwendung eines Diskussionswerkzeugs zur vorgeburtlichen Bedarfsermittlung. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 25 (3), 210-222.
Monk, C., Leight, K.L. & Fang, Y. (2008). Die Beziehung zwischen dem Bindungsstil von Frauen und der perinatalen Stimmungsstörung: Auswirkungen auf das Screening und die Behandlung. Archiv für psychische Gesundheit von Frauen, 11 (2), 117-129.
Ramchandani, P. G., Richter, L. M., Stein, A. & Norris, S. A. (2009). Prädiktoren für eine postnatale Depression in einer städtischen südafrikanischen Kohorte. Journal of Affective Disorders, 113 (3), 279 & ndash; 284.
Robertson, E., Grace, S., Wallington, T., Stewart, D.E. (2004). Vorgeburtliche Risikofaktoren für postpartale Depressionen: eine Synthese der neueren Literatur. Allgemeine Krankenhauspsychiatrie, 26 (4), 289-295.
Ross, L. E. & Dennis, C-L. (2009). Die Prävalenz postpartaler Depressionen bei Frauen mit Substanzkonsum, Missbrauchsanamnese oder chronischer Krankheit: Eine systematische Übersicht (PDF). Journal of Women’s Health, 18 (4), 475-486.
Zajicek-Farber, M.L. (2009). Postnatale Depressionen und Gesundheitspraktiken bei Säuglingen bei Hochrisikofrauen. Journal of Child and Family Studies, 18 (2), 236-245.